Provinz im heutigen deutschen Sprachgebrauch ist ein negativer Begriff – im logischen Sinne: Wer Provinz denkt, denkt automatisch das andere mit: Metropole. Und zwar als Maßstab. Provinz ist das Gegenteil davon, und das ist durchaus wertend gemeint.
(Foto oben: documenta 2012 in Kassel)
Provinz ist nicht nur der ländliche Raum oder die Kleinstadt. Provinz meint das Versanden der geistigen, kulturellen, politischen Errungenschaften oder Standards der städtischen Eliten im Quadrat des Abstands zur Stadt. Am deutlichsten wird das, wenn die Provinz zum Adjektiv wird: provinziell ist ein Synonym für rückständig.
Was aber immer für negative Bestimmungen gilt, gilt auch für die Verachtung der Provinz: sie verrät wenig über die Provinz selbst – außer dass sie nicht die Metropole ist, was sie ja auch gar nicht sein will –, eher schon etwas über den Urteilenden: der fühlt sich natürlich nur in der Großstadt wohl.
Denn der Reigen der negativen Assoziationen zu Provinz ließe sich ja auch umkehren. Wo „nichts los“ ist, findet man auch Ruhe, Zeit und Besinnung auf das Wesentliche. Wo die kulturelle Avantgarde nicht zählt, schätzt man Traditionen und Bewährtes. Wo das (groß-)städtische Leben fehlt, ist man der Natur um so näher. Und so weiter. So ungefähr sieht man das auch in der Provinz. Aus gutem Grund.
Provinz im negativ wertenden Sinne bezeichnet nicht nur einen ländlich-kleinstädtisches Lebensalltag, sondern letztlich eine Geisteshaltung, die Provinzialität in den Köpfen, die sich den kulturellen Moden, den zwischenmenschlichen Verhaltensmustern oder politischen Standards, wie sie in den Metropolen anzutreffen sind, verweigern. Die spannende Frage hier aber lautet: wann und wieso fehlt Provinz selbst etwas, wenn sie provinziell ist und bleiben will?
Denn eines darf beim Nachdenken über die Provinz nicht übersehen werden. Provinz und kapitalistische Akkumulation, der Maßstab gesellschaftlichen Erfolges, geht gut zusammen! Der berühmte deutsche Mittelstand sitzt überwiegend dort – nicht nur im Baden-Württembergischen Schwarzwald, inzwischen auch in der Oberpfalz, in Friesland, Mittelthüringen oder Ostwestphalen. Vielleicht auch bald wieder im sächsischen Erzgebirge, wo heute noch im kleinsten Ort zahlreiche Gründerzeitbauten von einer erfolgreichen provinziellen Industriekultur zeugen.
Zumindest für die jüngere deutsche Geschichte gilt: Provinz ist kein Synonym für Armut und Arbeitslosigkeit! So wird das schon mal nichts mit der Rückständigkeit!
Dennoch bin ich der Ansicht, daß unter den aktuell zu verzeichnenden demographischen Entwicklungen und der zunehmenden Migration der jungen Leute in die Metropolen Deutschlands Provinzen unter gewissen Umständen mit Ihrer Provinzialität ein Problem bekommen könnten, wenn Sie es nicht schon haben. Daß sie ihre Chancen und Potentiale, junge Menschen attraktive Lebensräume zu bieten, nicht erkennen und somit auch nicht nutzen.
Und da bekommen Kultur und Kulturpolitik neben den alten humanistischen Bildungsidealen plötzlich zunehmend und unerwartet handfeste wirtschaftspolitische Fundamente.
Aber der Reihe nach.
Sie hassen die Provinz – so titelte die ZEIT im September letzten Jahres und beschrieb damit ein „Schwarmverhalten“ der überwiegend jungen Menschen wie folgt:
Überall sind junge Menschen abgewandert, vom platten Land und aus Städten wie Duisburg, Remscheid, Salzgitter oder Bremerhaven. Ihr Ziel sind die wenigen Städte, in die alle wollen. Berlin, Hamburg und München gehören dazu, aber auch Würzburg, Leipzig, Mainz und Bamberg. (…) Was man auf den Karten sieht, lässt sich nicht mehr als Ost- oder Landflucht beschreiben. Es ist eine Wanderung neuen Typs. „Im ganzen Land“, sagt Simons, „fliegen die Vögelchen hoch, bilden einen Schwarm und fallen dann in immer die gleichen Städte ein.“ (DIE ZEIT Nº 40/2014 vom 25. September 2014)
Die vier Kernaussagen des Artikels lauten:
1. Arbeitsplätze sind keineswegs das handlungsleitende Muster dieser Schwärme! 2. Hohe Mieten habe keine abschreckende Wirkung, sondern signalisieren im Gegenteil hohe Lebensqualität! Da will ich hin! Soviel zur unsichtbaren „Hand des Marktes“. 3. Das von jungen Menschen geprägte urbane Leben zieht auch ältere Menschen an. 4. Dieses Verhaltensmuster kennt keine Ost-West-Unterscheidung mehr. Städte wie Halle und Würzburg sind cool und ziehen junge Menschen an, Städte wie Hagen im Ruhrgebiet, Siegen oder Frankfurt/Oder sind uncool und verlieren sie, selbst wenn sie Universitätsstädte sind.
Wir haben es mit einem Paradigmenwechsel zu tun. Früher sind die Menschen deutlicher den Jobs hinterhermigriert, heute prüfen Sie auch das Kita-Angebot und die Modeboutiquen der Stadt für ihre Work-Life-Balance. Stadt ist heute ein soziales Dauer-Event, zu erleben schon beim Milchholen im alternativen Bioladen an der Ecke. Der Verzicht auf das eigene Auto fällt leicht, wenn man die hippe Alltagskultur vor der Hauseingangstüre hat. Das Auto ist hier schon lange kein Statussymbol mehr. Eher noch die Adresse: Ottensen, Prenzlberg, Glockenbach!
Was das mit Kultur zu tun hat? Das ist sie!
Es ist der Filzladen mit den wunderbaren Hüten und Taschen, und der Burger-Take-Away, wo es bestes Beef gibt, auf das man zwischen rohen Wänden warten muß. Es ist der Poetry Slam und das Café, das kuschelt wie ein Pariser Wohnzimmer und in dem ich mich mit dem aktuellen brand eins ins gepolsterte Schaufenster setzen kann. Es sind die Galerien, die Jazz-Kneipe, die Langen Nächte und die Festivals, das Programmkino und das Theater.
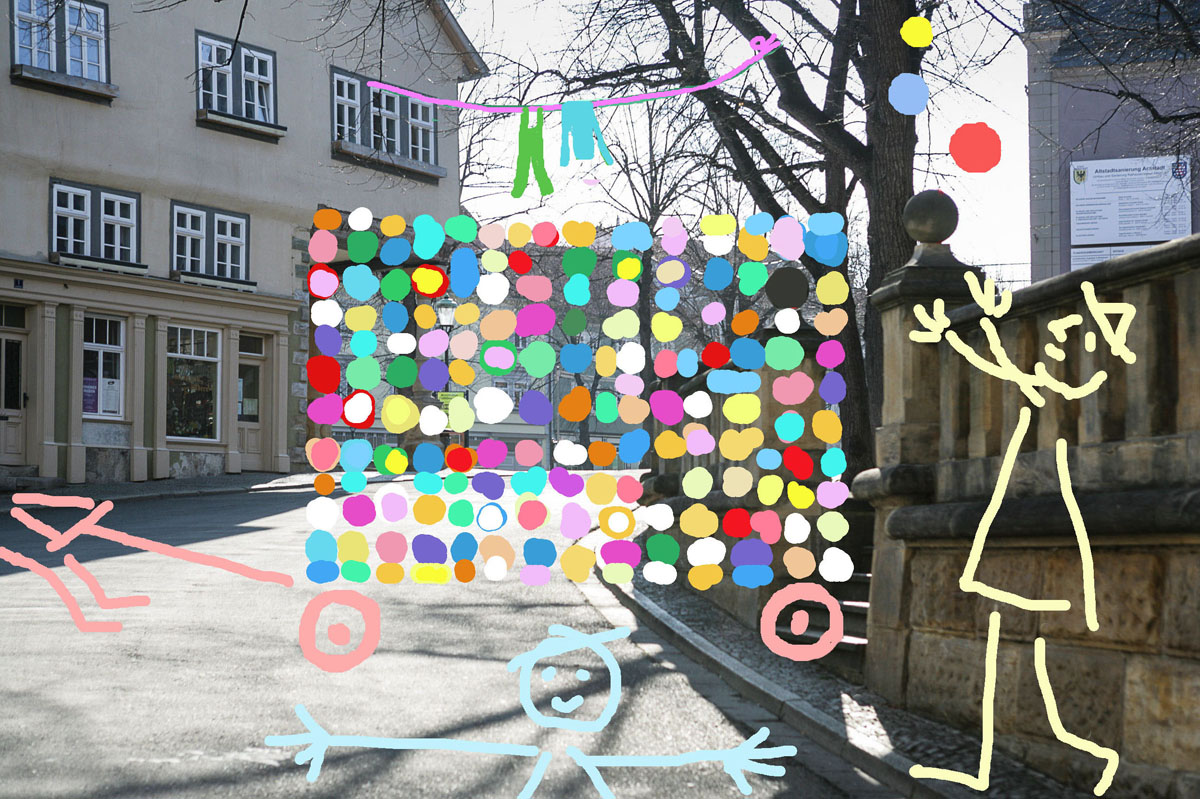
Es ist alles nebeneinander auf kleinstem Raum, in historischen Gebäuden, die sich zu ihrer Geschichte bekennen dürfen, ja sollen.
Denn nichts ist uncooler als Neubauten.
Es ist die Europäische Stadt, die auf diese unerwartete Weise ein furioses Revival erlebt und die städtebaulichen Konzepte der modernen „autogerechten Stadt“ und anderer Modernisierungsversuche von Architekten Lügen straft, die in der Nachkriegszeit von der absurden Trennung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit dozierten und die bis heute in den Köpfen von Stadtplanern steckt.
Wenn also die Schwarmbewegung der Jugend allen Kommunen Probleme bereitet – den Regionen, aus denen sie sich zurückzieht ebenso wie den Städten, in die sie einfällt und die Mietpreise ins Absurde treibt – sie zeichnet zugleich den Weg vor, wie zumindest Teile dieses Schwarms auch umzulenken sind.
Denn die meisten der kleinen Städte haben immer noch die hardware zu dieser lebendigen Stadt, die sie jahrhundertelang waren: schöne historische Bauten, die ihrer Inbesitznahme harren, gewachsene städtische Plätze und Grünanlagen, und eine sie umgebende rasch zu erreichende Kulturlandschaft mit hohem Freizeitwert.
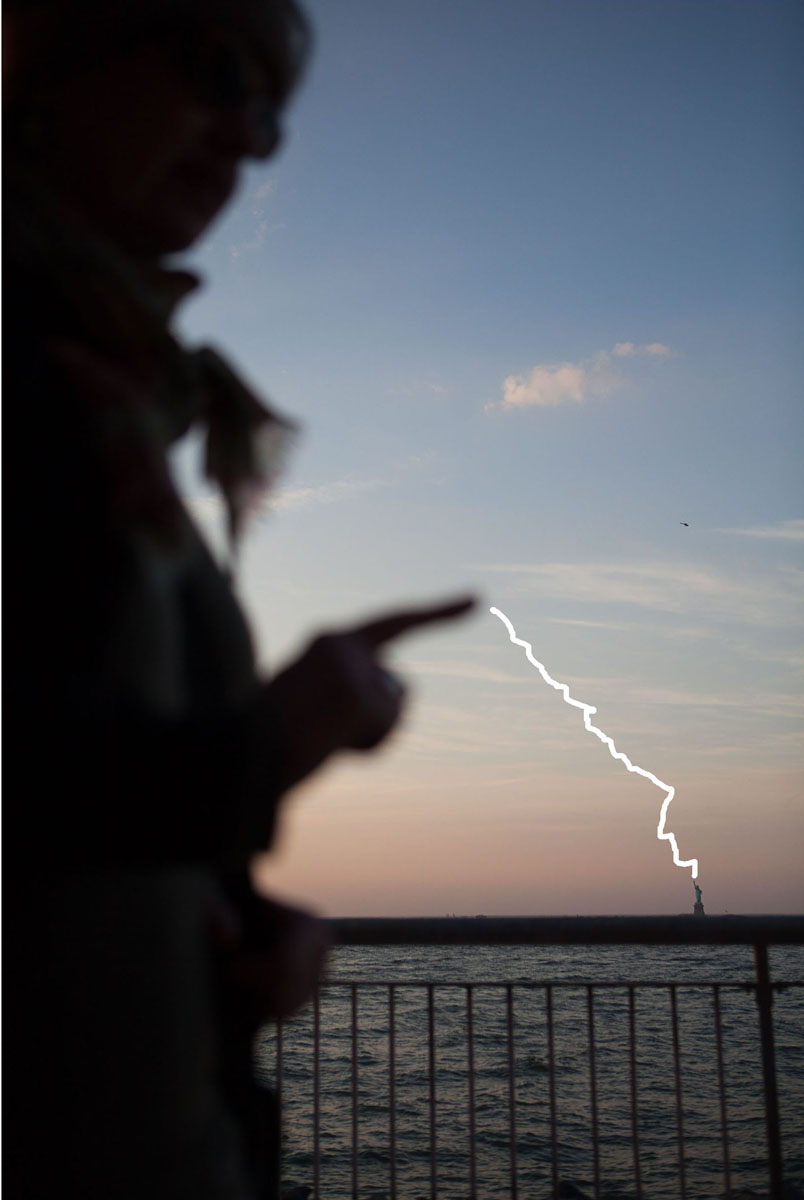
Allein was fehlt sind die Ideen, wie diese Räume zu bespielen seien.
Um das an einem Beispiel einer Thüringer Kleinstadt zu verdeutlichen: es ist ja nicht so, dass es in meiner Heimatstadt Arnstadt keine jungen Leute gäbe, die ein Café oder eine Kneipe eröffnen wollen, und dies auch in einem schönen alten Gebäude tun. Doch so schön die Fassade, so ernüchternd ist regelmäßig der Eindruck innen: abgehängte Decken, schmatzendes Holzimitat-Laminat, akkurat verputzte Wände und Möbel aus dem Katalog. Der Eindruck: ein Raum ohne Gesicht, wie er überall auf der Welt stehen könnte. Der Kaffee natürlich aus dem Vollautomaten.
Man fragt sich: reisen diese jungen Unternehmer nicht? Nach Berlin, Warschau oder Kopenhagen, um zu sehen, was heute ein Café ist, um dort die Ideen einzusaugen, die man dann zuhause umsetzt. Glauben Sie wirklich, ein Bistro ist dann erfolgreich, wenn es von tausend anderen nicht zu unterscheiden ist? Reisen wir nicht um zu lernen? Oder nur um zu baden oder zu wandern?
Glücklich wird damit niemand. Nicht die junge Familie, die einen Job am Erfurter Kreuz angeboten bekommen hat und nun die städtische Kneipenszene checkt, nicht das städtische Bürgertum, das nach Erfurt fährt, wenn es einen Stadtbummel machen und einen echten Capuccino trinken will, nicht der Cafébetreiber, dessen Umsatz kaum die Kosten deckt, nicht die Stadt, deren Zentrum mangels attraktiver Angebote zu veröden droht.
Das ist das Problem, das die Provinz mit sich hat, denn hier trifft eine bodenständige provinzielle Jugend in Widerspruch zu den modernen Migranten des Arbeitsmarktes und der Eventkultur, die mit ihrem Urteil schneller fertig sind, als der einheimische Gastronom seine Plastestühle vor die Türe stellt.
Umso perfekter die Gewerbegebiete erschlossen wurden, umso üppiger die Fördermittel fließen und umso mehr die qualifizierten Mitarbeiter umworben werden, desto mehr wird den Spitzen der Verwaltungen und der Unternehmen in der Provinz bewußt, dass sie ein Standortproblem der neuen Art haben: ein an heutigen Maßstäben unattraktives städtisches Leben ohne ausreichende Kita-, Kneipen- und Kreativkultur.
Die Aufgabe ist klar: wie importiert man szenengängiges Knowhow aus den Metropolen in die Kleinstadt und verankert es dort? Antwort: Indem man Angebote schafft und dafür sorgt, dass sie funktionieren. Indem die Stadt eigene Gebäude und Räume gezielt und kostenlos oder -günstig Kreativen überläßt, die ein überzeugendes Konzept haben. Indem man – wie in Halle – Straßenfestivals veranstaltet oder – wie für Arnstadt als Quinquennale Analoge Stadt konzipiert – internationale Künstler einlädt, einen Sommer lang ungenutzte Gebäude als Atelier, Galerie, Werkstätte, Bühne und Kneipe zu verwandeln. Indem man Förderinitiativen einrichtet für originelle Cross-Over-Läden wie ein Buchhandlungs-Café oder einen Schoko-Laden-Friseur.
Indem man also beginnt, das Problem zur Kenntnis zu nehmen. Zur Abhilfe Beratung einzuholt und Geld in die Hand nimmt. Mehr denn je zuvor wird sich dann zeigen, daß die ausgegebenen kommunalen Euro für Kultur Schlüsselimpulse setzen. Denn es ist ja keineswegs so, dass es nicht genügend junge Leute gäbe, denen der Mietwahnsinn der Metropolen nicht auf die Nerven geht und die es umgekehrt nicht schätzten, sich von der Haustüre weg im nullkommanichts mit dem Fahrrad in einer einmalig schöner Kulturlandschaft zu bewegen.
Halle ist ein wunderbares Beispiel dafür, nichts zu geben auf professorale Prognosen und kommunalen Defaitismus, der sich auszukennen glaubt nach dem Grundsatz: „Das mag ja in der Großstadt funktionieren, aber nicht bei uns“. Als hätten sie es je probiert. Ich erinnere mich noch gut, wie vor zehn Jahren, als wir nach Thüringen zogen, Halle Schlagzeilen machte als Stadt, die man abschreiben könne. Jetzt können wir von Halle lernen:
Genau darum hat Halle sich erst mal gekümmert: um den kulturellen Aufschwung. Anschließend, sagt Oberbürgermeister Wiegand, sei es auch einfacher, um Unternehmen zu werben. Für ihn hat sich die Reihenfolge umgekehrt: Nicht mehr die Menschen folgen den Jobs, sondern die Jobs den Menschen. (Die ZEIT)
Links zum Thema:
http://stadtrandnotiz.de/2017/09/07/stirbt-die-stadt-stirbt-die-gemeinschaft/
http://www.stadtrandnotiz.de/category/analoge-stadt/
http://www.zeit.de/2014/40/schwarmstaedte-mieten

Gute und interessante Analyse, gute Einsichten. Hoffentlich können wir etwas daraus machen!