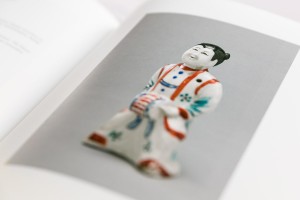von Pankaj Mishra
Pankaj Mishra ist ein indischer Schriftsteller, der 2014 mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet wurde. Dieser Text erschien am 21. März 2024 für The London Review of Books und wurde mit Deepl aus dem Englischen ins Deutsche übertragen. Er gibt eine kulturhistorische Einordnung des Zionismus nach 1945 und schildert kenntnisreich die verschiedenen Schattierungen der westlichen Wahrnehmung des Staates Israels.
Der Artikel erschien am 28 Februar 2024 im Original hier.
– – –
1977, ein Jahr vor seinem Selbstmord, stieß der österreichische Schriftsteller Jean Améry auf Presseberichte über die systematische Folterung arabischer Gefangener in israelischen Gefängnissen.
Améry, der 1943 in Belgien beim Verteilen von Anti-Nazi-Pamphleten verhaftet worden war, wurde selbst von der Gestapo brutal gefoltert und dann nach Auschwitz deportiert. Er überlebte, konnte aber seine Qualen nie als etwas Vergangenes betrachten. Er bestand darauf, dass diejenigen, die gefoltert werden, gefoltert bleiben und dass ihr Trauma unwiderruflich ist.
Wie viele Überlebende der Nazi-Todeslager fühlte sich Améry in den 1960er Jahren mit Israel „existenziell verbunden“. Er griff linke Kritiker des jüdischen Staates obsessiv als „rücksichtslos und skrupellos“ an und war vielleicht einer der ersten, der die heute von Israels Führern und Befürwortern gewohnheitsmäßig wiederholte Behauptung aufstellte, bösartige Antisemiten würden sich als tugendhafte Antiimperialisten und Antizionisten tarnen.
Doch die „zugegebenermaßen dürftigen“ Berichte über Folterungen in israelischen Gefängnissen veranlassten Améry, die Grenzen seiner Solidarität mit dem jüdischen Staat zu überdenken. In einem der letzten von ihm veröffentlichten Essays schrieb er:
„Ich rufe alle Juden, die Menschen sein wollen, dringend auf, sich mir in der radikalen Verurteilung der systematischen Folter anzuschließen. Wo die Barbarei beginnt, muss auch das existenzielle Engagement enden.„
Die Shoa nach Gaza. weiterlesen